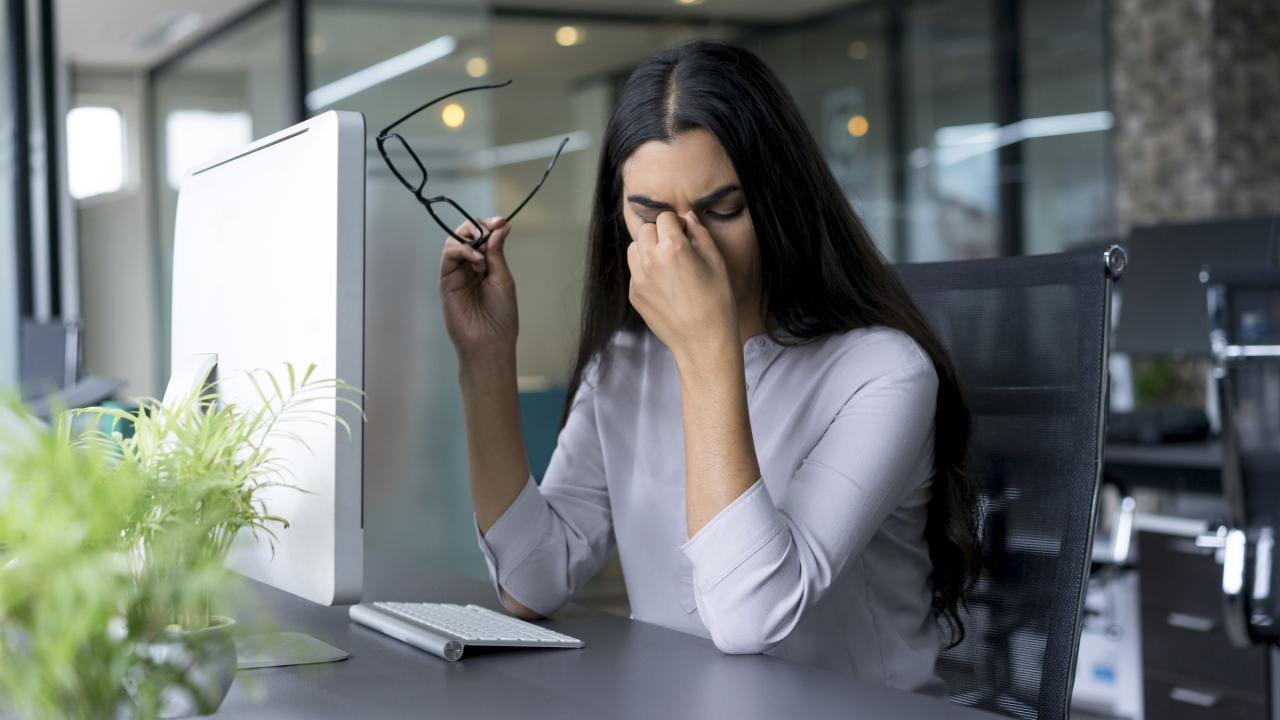Behauptung: „In Deutschland wird zu wenig gearbeitet“
Fakt ist: Vergleiche mit anderen Ländern sind oft irreführend. Beispiel: Eine Statistik der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die häufig zitiert wird. Die Statistik zeigt, wie viele Arbeitsstunden Beschäftigte im Durchschnitt pro Jahr leisten. Deutschland liegt dabei hinten. Doch dazu muss man wissen: Die OECD weist selbst darauf hin, dass die Daten nicht geeignet sind, um Länder in konkreten Jahren miteinander zu vergleichen.
Um zu beurteilen, wie viel in Deutschland gearbeitet wird, sind andere Zahlen wichtig. Zum Beispiel das Arbeitsvolumen – also die Zahl aller geleisteten Arbeitsstunden. Diese Zahl liegt auf Rekordniveau. 2023 haben Beschäftigte in Deutschland rund 54,6 Milliarden Arbeitsstunden geleistet.1991 waren es noch 52,2 Milliarden Stunden. Auch die Zahl der Erwerbstätigen erreichte zuletzt Höchststände.
Beide Rekordwerte haben denselben Hintergrund: Heute arbeiten mehr Frauen als früher. Allerdings arbeitet fast jede zweite erwerbstätige Frau Teilzeit – oft unfreiwillig, zum Beispiel wegen fehlender Kinderbetreuung. Die hohe Teilzeitquote senkt die durchschnittliche Arbeitszeit pro Kopf.
Hinzu kommt: Beschäftigte in Deutschland leisten jedes Jahr hunderte Millionen Überstunden. Mehr als die Hälfte davon unbezahlt.
Behauptung: „Länger arbeiten kurbelt die Wirtschaft an“
Feiertag streichen + Arbeitszeit ausweiten = Wirtschaftswachstum. So einfach stellen sich das manche vor. Mit der Wirklichkeit einer modernen Volkswirtschaft hat das wenig zu tun.
Unternehmen planen die Abarbeitung ihrer Aufträge so, dass sie möglichst an Werktagen erledigt werden. In der Industrie fehlt es derzeit an Aufträgen – und damit vielerorts auch an Arbeit. Weniger Feiertage würden an der schlechten Auftragslage nichts ändern. In manchen Branchen würden gestrichene Feiertage ein Minus bedeuten. Etwa im Tourismus und der Gastronomie.
Insgesamt gibt es keinen Beleg dafür, dass die Abschaffung von Feiertagen die Wirtschaftsleistung erhöht.
Die Abschaffung des Acht-Stunden-Tags als Normalfall könnte sogar kontraproduktiv sein: Weil überlange Arbeitstage krank machen können, könnte am Ende weniger statt mehr Arbeitskraft zur Verfügung stehen.
Grundsätzlich ist nicht die Länge der Arbeitszeit entscheidend, sondern die Produktivität. Also die Frage, wieviel Wohlstand pro Arbeitsstunde geschaffen wird. Für eine hohe Produktivität brauchen wir Zukunftsinvestitionen, gute Arbeitsbedingungen und gute Aus- und Weiterbildung. Vor allem beim letzten Punkt schlummert ein riesiges Potenzial: Knapp drei Millionen junge Menschen unter 35 Jahren haben keinen Berufsabschluss.
Behauptung: „Das deutsche Arbeitszeitgesetz ist unflexibel“
Fakt ist: Das Arbeitszeitgesetz bietet schon heute viel Flexibilität. Es erlaubt Zehn-Stunden-Tage, solange diese Mehrarbeit innerhalb von sechs Monaten ausgeglichen wird. Sogar Zwölf-Stunden-Tage sind für bestimmte Branchen und Tätigkeiten möglich. Auch Tarifverträge bieten eine Fülle von Möglichkeiten, Arbeitszeit flexibel zu regeln. Gewerkschaften und Betriebsräte sorgen dafür, dass die Interessen der Beschäftigten berücksichtigt werden – und die Arbeitszeiten nicht einseitig vom Arbeitgeber diktiert werden.
Behauptung: „Die EU-Richtlinie zur Arbeitszeit bietet mehr als genug Schutz“
Fakt ist: Die sogenannte EU-Arbeitszeitrichtlinie begrenzt die wöchentliche Arbeitszeit auf 48 Stunden. Für die tägliche Arbeitszeit ist keine direkte Begrenzung vorgesehen, sondern nur eine tägliche Ruhepause von mindestens elf Stunden am Stück. Arbeitstage könnten bis zu zwölf Stunden und 15 Minuten lang sein. Aus Sicht der Arbeitsmedizin eindeutig ein Gesundheitsrisiko für Beschäftigte.
Behauptung: „Der Acht-Stunden-Tag hält Eltern vom Arbeiten ab“
Kind zur Kita bringen, arbeiten, Kind abholen, versorgen und ins Bett bringen – und dann bis Mitternacht weiterarbeiten. So wünschen sich angeblich viele Eltern ihren Alltag. Abgesehen davon, dass das nur bei Schreibtisch-Berufen funktioniert: Die Realität der meisten Familien sieht anders aus. 97 Prozent der Beschäftigten wollen möglichst um 18 Uhr Feierabend machen.
Zersplitterte Arbeitstage – zum Beispiel Weiterarbeiten am Abend nach längerer Unterbrechung – führen zu Stress und kurzen Ruhezeiten. Die wenigsten empfinden das als Bereicherung. Für die meisten ist es eine Notlösung.
Ein Ende des Acht-Stunden-Tags hilft da wenig. Viel wichtiger wären bessere Kinderbetreuung und Wege aus der „Teilzeitfalle“.